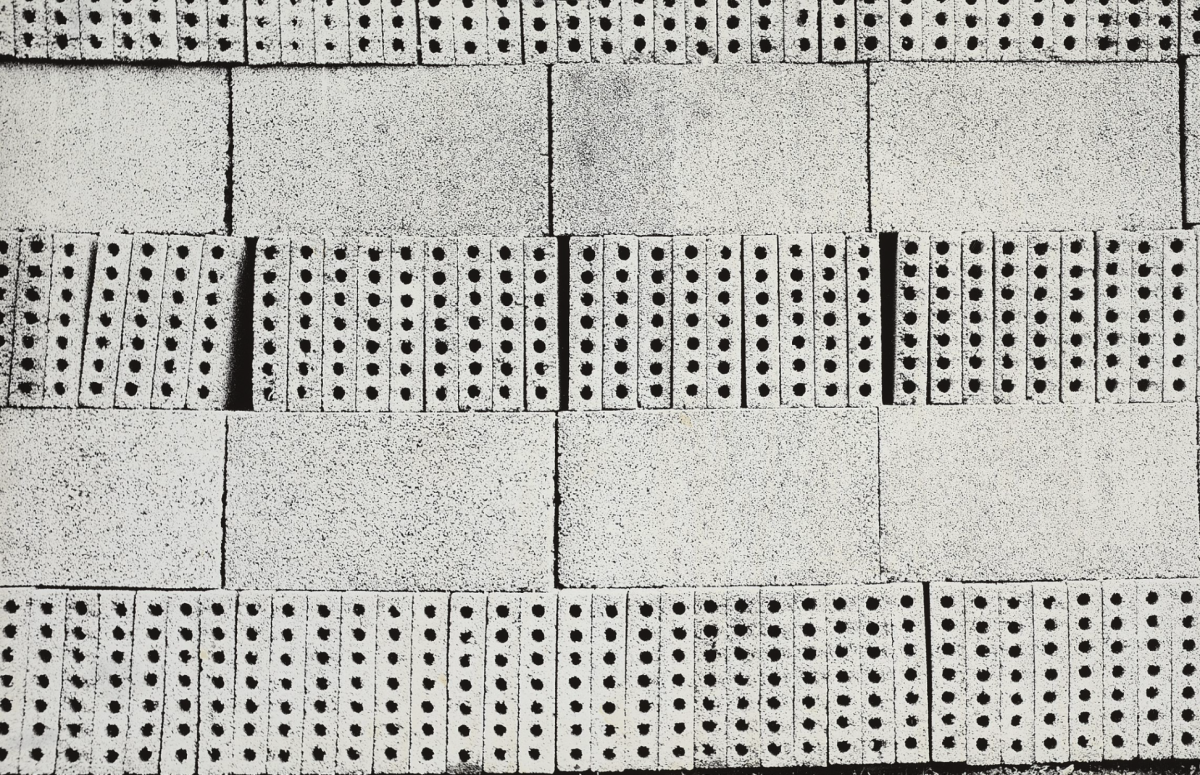Der Schweizerische Werkbund SWB ist ein nationaler Verein, der Mitglieder aus gestalterischen und handwerklichen Berufen in sich vereint. Seine Stärke ist sein inter- und transdisziplinärer Ansatz. Unter diesem Blickwinkel bearbeitet er gestalterisch, kulturell, gesellschaftlich, ästhetisch und wirtschaftlich zentrale Fragen.